|
Paul
Misch
Im Niemandsland
Tage
und Nächte blickten meine Augen in dieselbe Richtung. Irgendwo im
Wald und dahinter mußten die Angreifer sein. Mehrmals hatte ich
einzelne rennen sehen, zwischen den Stämmen der Bäume vorbeihuschen.
Gebückt, niemals aufrecht. In solchen Situationen war es ratsam,
nicht den ersten Schuß abzugeben. Die Schützen des Maschinengewehrs
MG 42, kaum fünfzig Schritt von mir entfernt, hielten sich
offensichtlich an diese Regel. An diesem Nachmittag blieben wir von
Artillerie- und Granatwerfersalven verschont. Aber es lag etwas in der
Luft. Ich spürte Unbehagen.
Tatsächlich, jetzt kam ein ganzer Zug amerikanischer Infanterie auf
mich zu, ohne erkennbaren Schlußmann. In wenigen Sekunden würden sie
mir auf meinen mit Herbstlaub getarnten Stahlhelm treten. Ebensowenig
wie ich "Eiserne Kreuze" an meiner Brust sammeln mochte,
hatte ich das Verlangen, Bilder von mir erschossener Soldaten im Gedächtnis
herumzutragen.
Aber ich mußte schießen. Aus allen Rohren feuerten sie zurück. Ohne
Verzögerung, blitzschnell. Ihr leichtes Maschinengewehr zersplitterte
alles. Vor, über und hinter mir. Glücklicherweise warf keiner eine
im Nahkampf gefürchtete Handgranate. Es ging um Bruchteile einer
Sekunde. Mein Kopf gab mir den klaren Befehl, die von mir bereits
abgeschraubten Verschlußkappen meiner zwei Eierhandgranaten wieder
aufzuschrauben, die Zünder nicht zu ziehen. Mein Zugführer, weit
hinter mir, feuerte etliche Stöße aus seiner Maschinenpistole. Sonst
war nur Einzelfeuer aus Karabinern zu hören. Was war nur mit unserer
stärksten Feuerkraft los? Weshalb ballerten die Maschinengewehre
nicht?
Ich preßte den Brief meiner Schwester Else-Martha an die Brust.
"Daß wir siegen, ist doch klar", hatte sie mir zu meinem
17. Geburtstag vor zwei Tagen geschrieben. "Und wenn die
Entscheidungsschlacht in Berlin ist", hatte sie noch hinzugefügt.
Meine Schwester hörte zu Hause die Stimme der Propaganda, die Stimme
Goebbels, aus dem Volksempfänger. Sie hatte keine Ahnung. Was wohl
unser Bruder Ernst bei der Kriegsmarine machte? Und Else-Marthas
Verlobter Willi in Rußland? "Daß ihr mir ja gesund
wiederkommt!"
Sie wollte uns unversehrt zurück.
Die Angreifer glaubten, unsere Feuerkraft sei ausgelöscht. Ich lag in
meinem Mauseloch in diesem verdammten, todbringenden Wald. Kameraden
waren gefallen. Als das gegnerische Maschinengewehr endlich sein
Tack-tack-tack eingestellt hatte, hob ich ganz langsam meinen Kopf.
Zum Überlebenswillen gehörte ein gewisses Maß an Neugierde.
Die Amerikaner machten keine Anstalten, sich zurückzuziehen, vielmehr
begannen sie, mit ihren kleinen Spaten sich einzubuddeln. Auch für
sie war es in der Erde sicherer. Daß ich in ihrer Nähe war, ahnten
sie nicht. Eine einzige gezielt geworfene Handgranate hätte mein
Leben ausgelöscht. Wenn ihre Wachposten Pfiffe von sich gaben, ließen
sie ihre Spaten zeitweise los. Hinter uns, im Dorf Merode, und um das
mächtige Schloß detonierten pausenlos Granaten.
Es wurde Nacht. Ihre brennenden Zigaretten hätten Zielscheiben
abgegeben. Aber würde ich mehr als einen Schuß aus meinem lahmen
Karabiner abfeuern können? Bei dieser Übermacht? Würden meine
Kameraden bis zu mir vorrobben können? Oder konnte ich es wagen, im
Schutz des Granatenlärmes mein Mauseloch zu verlassen?
Überall lag raschelndes Laub. Über mir Wolkenfetzen. Aus gutem Grund
hatte ich mich als Kriegsfreiwilliger zur Luftwaffe gemeldet. Statt am
Himmel zu kämpfen, hatte man mich in eine fast aufgeriebene
Fallschirmjägereinheit gesteckt. Wie sollte es nun weitergehen? War
ich schon abgeschrieben? Hatte man mich bereits als vermißt gemeldet?
Der Gedanke überzulaufen kam mir nicht. Solche Gedanken hatten mir
meine Ausbilder ausgetrieben. Für Führer, Volk und Vaterland zu
sterben sollte höchste Ehre sein.
Ich wagte mich nicht, eine Camel-Zigarette anzuzünden, die ich aus
dem Gepäck eines gefallenen Amis geklaut hatte. Eine ganze Stange
sogar. Die goldene Uhr ließ ich an seinem Handgelenk. Angespannt
lauschte ich in die Nacht. Ich hörte, wie die Soldaten leise
miteinander redeten. Ihre Sprache verstand ich nicht. Dann schlief ich
ein.
Bei Tagesanbruch wurde ich aus meinem befreienden Schlaf in die nackte
Wirklichkeit zurückgerissen, als der fliegende Artilleriebeobachter
der Amerikaner über den Baumwipfeln brummte. Jetzt konnte ich nicht
mehr zurückrobben. Nach ihrem Frühstück griffen die Amerikaner in
Richtung Hohlweg an. Sie liefen rechts, ganz nah an meinem Mauseloch,
vorbei. Vom Waldrand meldete sich ein MG 42, woraufhin sich die
Angreifer wieder in ihre schützenden Erdlöcher zurückzogen. Wie
durch ein Wunder blieb ich auch jetzt unentdeckt. Der "Eiserne
Gustav" mit seinen zwei Tragflächen und gierigen Augen lenkte
daraufhin das Granatwerferfeuer auf den Waldrand und ins Dorf.
Von meiner Truppe nicht gesucht, von den Amerikanern nicht bemerkt,
lag ich im Niemandsland. Zwei Tage lang und jetzt die zweite Nacht.
Hunger? Durst?
Auf keinen Fall durfte ich in dieser Nacht wieder einschlafen, denn
feindliche Soldaten wurden auch mal müde, und das war meine Chance.
Als Granaten am Waldrand einschlugen, rollte ich mich über das
raschelnde Laub. Meinen Karabiner hatte ich zurückgelassen, er hätte
mich nur behindert. Bei jeder neuen Salve kroch ich meinem Ziel ein Stück
näher. Irgendwo mußten doch die eigenen Linien sein!
Plötzlich blickte ich in einen Gewehrlauf. Mein Schrei "Nicht
schießen!" war schneller als das Abdrücken des Karabiners.
"Wo kommst du denn her?" fragte eine erstaunte Stimme.
Geschafft, ich war gerettet, vorerst.
Es war mir gelungen, nach dem Angriff der Amerikaner am 4. Dezember
1944 in Richtung Merode in der zweiten Nacht unbeschadet die
Auffangstellung der 1. Fallschirmjägerkompanie zu erreichen. In einem
Erdunterstand am Waldrand oberhalb des Schlosses Merode erfuhr ich, wo
der Rest der 2. Kompanie im Dorf zu finden sei …

Amerikanische
Soldaten vor dem zerstörten Schloß Merode. Hier und dahinter im Wald
hatten wir uns in der Nacht vom 10. zum 11. Dezember 1944 verschanzt.
Am 10.
Dezember 1944 bedrängten die Amerikaner den rechten Frontabschnitt außerhalb
des Dorfes mit Panzereinheiten und erzielten einen Durchbruch. Das
Dorf brannte an mehreren Stellen. Wir, der Rest der 2. Kompanie, mußten
zurück in den Wald. Diesmal durfte ich mich mit Michael, einem
erfahrenen
Fallschirmjäger, in ein vorhandenes Zweimannloch oberhalb des
Schlosses verschanzen. Im Fackelschein brennender Häuser und Scheunen
wurde etwas Eßbares verteilt. Uns wurde befohlen, unter allen Umständen
durchzuhalten. Es würde bald Ersatz kommen. Vermutlich wußten die
Offiziere von der ein paar Tage später beginnenden Ardennenoffensive.
Bevor wir einschliefen, erzählte mir Michael von seiner Verlobten in
Bayern. Er würde bald Vater werden und strebte eine Ferntrauung an.
Es mußte wohl während des letzten Fronturlaubs "passiert"
sein.
Als es am Morgen des 11. Dezember hell wurde, sahen wir hinter uns im
zerschossenen Merode fremde Fahrzeuge fahren und amerikanische
Soldaten laufen. Um den mächtigen Baukörper des Schlosses herum war
es ruhig geworden. Mit Widerstandsnestern hatte man kurzen Prozeß
gemacht, denn schließlich wollte man selbst überleben.
Wir zwei waren uns einig: Ruhig verhalten und nachts absetzen! Nur
jetzt nicht noch durch eine Dummheit Kopf und Kragen riskieren.
Kontakt zu Vorgesetzten und zu Kameraden hatten wir nicht mehr. Meine
Angst war riesengroß.
Bevor es wieder Nacht wurde, durchkämmten die Amerikaner den Wald.
Ich ließ meinem älteren Kameraden den Vortritt, dann erhob auch ich
die Hände. Unzählige Gewehrläufe waren auf uns gerichtet. Zum
ersten Mal sah ich ganz nah farbige Soldaten. In ihren dunklen
Gesichtern blitzten weiß ihre Zähne. Siebzehnjährige waren unter
den fremden Soldaten nicht.
Oelsnitz,
Sachsen - Bremen - Neerstedt, Niedersachsen
Januar-Sommer 1945
Renate
Rochner
Könnte ich doch in die Zukunft sehen!
Seit
1943 lebte ich in Oelsnitz im Vogtland. Wir Schülerinnen der Bremer
Oberschule für Mädchen an der Mainstraße waren durch die
Kinderlandverschickung hierher gekommen und bei Familien
untergebracht. Nachmittags durften wir die hiesige Oberschule nutzen.
Es war ein harter Winter 1944/45 mit viel Schnee und täglichen
Schreckensmeldungen in den Wehrmachtsberichten von der Ostfront. Die
Russen standen schon vor Breslau, und in Ostpreußen und Schlesien
waren Hunderttausende auf der Flucht. Ich hatte unterm Dach, zur Straße
hin liegend, ein eigenes kleines Zimmer. Eines Nachts im Januar 1945
wachte ich auf, weil ich von unten Knirschen im Schnee und ein Geräusch
wie das Schnauben von Pferden vernahm. Im Dunkeln stieg ich auf den
Tisch, um aus der Dachluke sehen zu können. Auf der Straße bewegten
sich Pferdewagen mit runden Verdecks mühsam vorwärts, Menschen
gingen daneben her, es dauerte Stunden, bis ich wieder einschlief.
Wir bekamen Einquartierung ins Haus, alle freien Zimmer mußten zur
Verfügung gestellt werden. Die Schulen wurden geschlossen. In den
Turnhallen wurden Flüchtlinge untergebracht. Wir Schülerinnen
schmierten Brote, schälten Kartoffeln und erfuhren schreckliche
Dinge. Der Treck zog weiter, in westliche Richtung. Doch bald trafen
die nächsten Flüchtlinge ein, jetzt auch mit der Bahn. Wenn in den
Personenwagen kein Platz mehr war, fuhren sie in Güterwagen. Kinder
erfroren unterwegs.
In einer der letzten Schulstunden hatte eine vorlaute Schülerin
gewagt zu sagen, was alle dachten: "Und wenn wir den Krieg nun
mal verlieren?"
"Aber Kind! So etwas dürfen wir nicht einmal denken!" empörte
sich unsere Lehrerin.
Unsere Lehrerinnen wollten nicht länger die Verantwortung für uns
mehr als 60 Mädchen übernehmen. Jetzt warteten wir auf die
Genehmigung aus Dresden, um mit dem Zug nach Hause fahren zu dürfen.
Alle Züge waren brechend voll, und niemand konnte ohne weiteres
einsteigen.
Auf die Fahrt durften wir außer Proviant nichts weiter mitnehmen.
Daher zogen wir mehrere Kleidungsstücke übereinander an. Jede ältere
Schülerin, ich selbst war inzwischen 15 Jahre alt, mußte eine jüngere
beaufsichtigen. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir unterwegs waren
und wie oft wir umsteigen mußten. Das geschah wegen der
Fliegerangriffe immer im Dunkeln. Ich erinnere mich an Nachtstunden in
Köthen bei Leipzig. Menschen drängten sich mit ihrem Gepäck auf den
Bahnsteigen. Keiner wußte, wann und wo der nächste Zug nach Norden
abfuhr. Schließlich kam einer, der in Richtung Hannover fahren
sollte. Abteile und Gänge waren schon überfüllt. Dennoch stürmten
die Leute hinein. Am schnellsten waren dabei die Soldaten, sie stiegen
gleich durchs Fenster ein. Wir hatten Glück, der Zug wurde nicht von
Tieffliegern angegriffen. Am anderen Morgen erreichten wir Hannover,
wo wir noch einmal umstiegen.

Unsere
Mutter mit uns sechs Kindern, ich stehe hinten rechts. Das Foto,
aufgenommen 1946, schickten wir unserem Vater nach Frankreich.
Endlich näherten wir uns Bremen. Die Domtürme standen noch, aber die
Innenstadt war ein Trümmerfeld, aus dem nur Schornsteine und
Mauerreste ragten. Ich machte mich zu Fuß auf den Weg in die
Neustadt, Straßenbahnen fuhren nicht mehr. Zwei Nachbarinnen, die mir
begegneten, erzählten, daß meine Mutter mit meinen vier jüngsten
Geschwistern auch gerade erst aus der Evakuierung zurückgekommen sei.
Unser Vater verließ seinen Arbeitsplatz in Bremen, um meine Mutter
mit den vier jüngsten Kindern aus der Lausitz zurückzuholen. Danach
mußte er an die Westfront. Sie hätten den Zug über Dresden verpaßt
und wären so dem grauenvollen Vernichtungsangriff auf diese Stadt
entgangen.
Plötzlich war Fliegeralarm. Ich rannte in den Hochbunker in der
Mainstraße.
Mein Bruder, 13 Jahre alt, der nach Reichenbach in Sachsen verschickt
worden war, kehrte ebenfalls gesund zurück. In der Folgezeit kamen
wir aus unseren Kleidern nicht mehr raus, ein Fliegeralarm jagte den nächsten.
In unserer Siedlung gab es nur die berüchtigten Erdbunker,
ausgehobene breite Gräben, mit Beton ausgegossen und einem Tonnengewölbe
aus Beton versehen, das außen mit Erde bedeckt war. Diese Bunker
wurden zu Massengräbern, wenn eine Bombe sie traf. Wir erlebten die
sogenannten Bombenteppiche, als der Bremer Westen in Flammen aufging.
Wir waren immer die letzten im Bunker, weil die kleinen Geschwister
erst aus dem Schlaf gerissen, dann im Handwagen verstaut und
hingefahren werden mußten. Die "Christbäume" standen schon
über uns und die Nebeltonnen waren bereits in Aktion, ehe wir die
Bunkertür erreichten. Eigentlich erwarteten wir jede Nacht unseren
Tod. Könnte ich doch in die Zukunft sehen, mußte ich oft denken,
dann wüßte ich, ob wir am Leben blieben.
Die Behörden beschlossen, daß Frauen und Kinder evakuiert und in der
Umgebung von Bremen untergebracht werden sollten. Na, da freuten sich
die Bauern!
Mit zwei Koffern und allen Geschwistern ging es per Bahn nach
Neerstedt, südwestlich von Bremen. Dort stand ein Pferdewagen am
Bahnhof, auf den so viele Frauen und Kinder wie nur möglich
aufstiegen. Der Kutscher war ein 14jähriger Junge. Es war bereits
dunkel. Über uns brummte ein feindliches Geschwader Richtung Bremen.
Als einige Flak-Geschütze in der Nähe zu ballern anfingen, ging das
Pferd durch, raste wie verrückt. Die Frauen und Kinder kreischten vor
Angst. Bei der Unterbringung waren wir natürlich die letzten. Wer
wollte schon eine Frau mit sechs Kindern aufnehmen?
Schließlich landeten wir auf einem heruntergekommenen Bauernhof in
Wehe. Zwei Bettrahmen mit Matratze zu ebener Erde waren unsere
Schlafstelle. In einer kleinen Küche konnten wir Essen kochen. Das
Holz zum Feuern stahlen mein Bruder und ich anfangs im Dunkeln aus dem
Schuppen. Hier konnten wir endlich nachts schlafen. Der Bäuerin
nebenan halfen wir bei der Arbeit, dafür gab sie uns Milch,
Kartoffeln und Butter. Mein Bruder lernte auf ihrem Hof sogar das
Melken.
Die ländliche Idylle sollte nicht lange dauern. Beim Holzsammeln
beobachteten wir einen Luftkampf und mußten mit ansehen, wie auch die
Kühe auf der Weide beschossen wurden. Vom Westen her näherte sich
die Front. Nachts hörten wir dumpfes Grummeln, das immer stärker
wurde. Dann sogar einzelne Artillerieabschüsse. Für eine Nacht
quartierten sich Soldaten auf dem Hof ein. Wir sahen ihnen zu, wie sie
ihre MG-Munition aufzogen. Die jungen Männer waren gut gelaunt. Am nächsten
Morgen waren sie verschwunden.
Als wir MG-Feuer hörten, wußten wir, daß die Front uns erreicht
hatte. Weil wir uns im Haus nicht sicher fühlten, versteckten wir uns
über Nacht in einer leeren Kartoffelmiete. Am nächsten Morgen saß
meine Mutter draußen und weinte. Sie, die immer wußte‚ was zu tun
war!
Jetzt bekam auch ich Angst. Wir vergruben unsere Papiere und unser
Federbett. Die Bäuerin und ihre Mutter versteckten ihre Schinken und
Mettwürste. Wir beschlossen, uns mit einem Fahrrad, auf das wir ein
paar Sachen luden, auf den Weg nach Bremen zu machen. Als wir losgehen
wollten, sahen wir, wie auf der Landstraße aus Ohe kommend, eine
endlose Reihe von Panzern anrollte. Wir kehrten um, gingen zurück ins
Haus. Wir fürchteten uns vor den feindlichen Soldaten. Sie kamen
immer in Gruppen. Die ersten Amerikaner wollten nur Hühner und Eier,
die nächsten bedrohten uns mit ihren Gewehren. Ein farbiger Soldat
zwang meine Mutter in den Nebenraum und vergewaltigte sie.
Nachts überfielen Fremdarbeiter die Bauernhöfe. Vielfach rächten
sie sich jetzt dafür, daß sie bei Nacht und Nebel aus ihren Ländern
geholt und zur Arbeit in Deutschland gezwungen worden waren. Später
brachte die Besatzungsmacht die Ostarbeiter vorübergehend in Lagern
unter. Für uns waren es Nächte voller Angst. (...)
Fürth
- Bexbach, nahe Neunkirchen, Saarland
28. Januar 1945-20. März 1945
Rudi
Brill
Fronthelfer der Hitler-Jugend
Ich war
15 Jahre alt, als am 1. September 1944 mein Einsatz als Fronthelfer in
Fürth begann. Zu Hause war ich in Zweibrücken, 30 Kilometer
entfernt. In den Monaten bis Kriegsende habe ich meine Gedanken und
Erlebnisse meinem Tagebuch anvertraut

Gerade
nochmal davongekommen. Diese Aufnahme von mir entstand kurz nach
Kriegsende.
Fürth,
28. Januar 1945: Ich hatte mir vorgenommen, täglich einen Psalm zu
lesen. Wenn ich beim 150. angelangt bin, so hoffte ich, wäre der
Krieg aus oder wenigstens der Einsatz. Grinsen muß ich über mich
selbst, daß ich Leichtgläubiger dachte, nach spätestens drei Wochen
sei der Einsatz vorbei. Nun dauert er schon fast fünf Monate. Schule?
Existiert so was eigentlich noch?
Schulklingel, Klassenzimmer, Tafel, Landkarten, Hefte, Bücher,
Pauker, Turnen, Englisch, Latein, Mathematik‚ Religion, Angst vor
der Klassenarbeit, nichtgemachte und morgens fünf vor acht schnell
abgeschriebene Hausaufgaben, der "Rex", blauer Warnbrief vor
dem Sitzenbleiben, Schulärger mit den Eltern. Was war das eigentlich
alles?
Jetzt ist das alles ausgetauscht durch: Einsatz, Trillerpfeife,
Tagesplan, Pickel, Schaufel, Axt und Beil, Itze, unser Ausbilder,
weltanschauliche Schulung, Singen von Liedern der Bewegung,
Essenfassen, Geschirrspülen, Sockenstopfen, Knopfannähen, Fingernägel-,
Schuh- und Unterkunftsappell, Waffenkunde, Marschieren, Exerzieren,
Geländekunde, Postempfang, Briefeschreiben, Nacktbrausebad, Wäscheabgabe
und Wäscheempfang, Aufenthaltsraum, Schulungsraum ... Das ist jetzt
unser Lebenskreis. War jemals was anderes?
6.
Februar: An den beiden kleinen Brücken an der Straße zum Bahnhof
bauen wir Talsperren, damit das Tal unter Wasser gesetzt werden kann
als Panzerhindernis. Wir kippen in den Wasserdurchlaß unter der Straße
Sandsäcke, Bohlen und Steine und lassen nur eine kleine Öffnung, die
leicht geschlossen werden kann. Bei all dem überlegen wir immer
wieder, wer das alles mal beseitigen muß, die Panzergräben,
Stellungen, Talsperren, Straßenhindernisse usw.
Den Eltern und Verwandten habe ich heute geschrieben, sie möchten auf
ihren Briefen und Karten keinen Absender mehr angeben. Wenn ich eines
Tages hier irgendwie verschwinde, soll niemand einen Anhaltspunkt
haben, wo ich zu finden bin.
17.
Februar: Paul brachte einen kleinen Transport von Jungen zur Auffüllung
unserer Schar. Er erzählte von unserer zerstörten Stadt und bestätigte,
daß unser Haus völlig ausgebrannt sei und die Säulen zwischen den
Schaufenstern aussähen wie eine griechische Tempelruine. Auch die
Dienststelle mußte umziehen in die Lammstraße. Sie ist ständig
besetzt. Paul hat abwechselnd Tag- oder Nachtdienst. Trotzdem ist er
viel besser dran als ich, denn er kann in Ixheim bei seinen Eltern
wohnen; ich gönne es ihm. Er ist mir stets ein guter,
freundschaftlicher Schulkamerad gewesen. Ein Jahr älter als ich,
rechnet er damit, bald zum Reichsarbeitsdienst eingezogen zu werden.
Wann werden wir uns dann einmal wiedersehen? Herzlich verabschiedeten
wir uns voneinander: "Machs gut!"
Für die Neuankömmlinge sind wir nun schon alte Hasen. Unsere
Gefolgschaft ist, eben weil sie so klein ist, doch sehr aufZack. Mit
ltze vertrage ich mich seltsamerweise ganz gut. Vielleicht hat ihm
imponiert, daß ich mein Versprechen gehalten habe und aus dem
Weihnachtsurlaub zurückgekommen bin. Nur der Bannführer ist für
mich nach wie vor eine Schreckfigur. Zum Glück sehen wir ihn nicht
oft.
22.
Februar: Auf der Höhe 393 zwischen Fürth und Lautenbach ziehen wir
Laufgräben zwischen den Bunkern. Auch 30 cm hohe Stolperhindernisse
haben wir beiderseits der Straße angelegt. Das sind in die Erde
gerammte Pfähle, über die einfacher Draht gespannt ist. Wir stellen
uns plastisch vor, wie die dummen Amerikaner heranstürmen, stolpern
und damit kampfunfähig werden. Hahahahaha!
3. März:
Wie üblich marschierten wir zu unserer Baustelle auf der Höhe 393
zwischen Fürth und Lautenbach. Oben auf dem Berg stapften wir über
ein weites Stück freies Land. Plötzlich tauchten ein paar Jabos auf,
hinter einem Wald hervor und beschossen unten im Tal ein Auto. Da
waren sie auch schon über uns und hatten uns entdeckt.
"Volle Deckung!" schrie ltze. Doch hier gab es keine. Kein
Baum, kein Strauch, kein Graben, kein Loch in der Nähe. Wir warfen
uns platt auf den Boden.
Die vier Flugzeuge stießen tiefer und umkreisten uns. Wir wußten, daß
sie auf einzelne Leute, auf Zivilisten, ja sogar auf Frauen, auf
Bauern auf dem Felde schossen. Und wir lagen da wie auf dem Präsentierteller.
Kaum war ein Flieger weg, war schon der nächste da. Einer flog so
niedrig, daß wir das Gesicht des Piloten erkennen konnten, der
seitlich aus dem Kabinenfenster auf uns schaute. Bei jedem Anflug
glaubten wir, jetzt schießt er, und drückten uns an die kalte Erde.
30 Jungen über wenige Quadratmeter kreuz und quer. Wenn das kein
lohnendes Ziel war!
Mit einem Mal ging eine der "Thunderbirds" noch tiefer und
stieß direkt auf uns zu. Es war wirklich ein "Donnervogel",
fürchterlich das Dröhnen des Motors. Wir krallten uns noch fester an
den Boden. Einer schrie, daß es das Donnern übertönte: "Jetzt
ist es aus!"
Wir glaubten das alle. Eine MG- oder Bordkanonengarbe, eine kleine
Bombe in unsere dichte Masse - da wäre keiner davongekommen. Mit 15
will man ja noch nicht sterben!
Ein Stoßgebet, verzweifelt, innig wie noch nie, ging mir durchs Herz:
"Lieber Gott, hilf uns!"
Eine unbeschreibliche, nie vorher gekannte Ruhe kam über mich. Ich fühlte
es fast körperlich: Gott hält jetzt seine Hand über uns. Tausend
Gedanken schossen mir in diesen Sekunden durch den Kopf. Jetzt muß er
schießen, jetzt, jetzt!
Doch der Bomber dröhnte über uns hinweg, war vorbei, hatte nicht
geschossen. Jaulend zog die Maschine hoch und auch die nächste flog
weiter. Halb betäubt vom Lärm staunten wir, daß wir noch lebten.
Wir hoben die Köpfe von der Erde. Noch ein paarmal umkreisten sie
uns, jetzt höher. Sie waren sich wohl nicht schlüssig. Was sie sich
wohl im Sprechfunk sagten?
Als die Flugzeuge für einen Augenblick die Kurve etwas größer
nahmen, taumelten wir, noch halb betäubt, hoch, rasten den Berg
hinunter, dem Laufgraben zu. Wir rannten, wie uns noch nie ein Führer
zum Laufen gebracht hatte, wir rannten um unser Leben, erreichten den
Graben und ließen uns hineinfallen, einer über den andern. "Es
zittern die morschen Knochen", haben wir oft gesungen. Wir haben
zwar keine morschen Knochen, aber unsere zitterten noch lange. Unsere
Gesichter strahlten, wir fielen uns um den Hals: "Mensch, nochmal
davongekommen, Menschenskind!"
Ein Dankgebet wie noch nie stieg aus meinem zerspringenwollenden
Herzen empor. Die Welt war neu für uns, das Leben begann noch einmal.
Da waren Bäume, Sträucher, Gras, Erde, Erde, die man fassen und
durch die Finger rieseln lassen konnte. Alles war wieder da, wir waren
noch da! Aus sicherer Deckung schauten wir zu, wie die Jabos noch eine
Weile kreisten. Warum sie nicht geschossen haben? fragten wir uns.
"Die werden uns in unseren graugrünen Drillichen für
Kriegsgefangene gehalten haben", vermutete einer. Das klang
plausibel. Für mich aber war es klar: Einer, der die Macht dazu hat,
hatte die Hände des Piloten am Abzug der Bordwaffen festgehalten,
damit er nicht schießen konnte.
Als die Maschinen endgültig verschwunden waren, liefen wir langsam
und mit weichen Knien den Berg hinauf zu der Stelle, an der unser
Leben beinahe geendet hätte. Wir sammelten unsere verstreut liegenden
Werkzeuge ein und gingen an die Arbeit. Den ganzen Morgen über war
das Geschehene unser Gesprächsthema. Mit welchen Gefühlen ich das
jetzt, nach zwölf Stunden, schreibe, kann ich nicht ausdrücken. Aber
was ich gewiß tun werde, heute und alle Tage, die mein Leben noch zählen
wird, ist, dankbar sein für jeden neuen Tag und für das noch einmal
geschenkte Leben. (...)
Bexbach,
17. März: Paul ist tot! Tot!
Das Wort glotzt mich an in seiner ganzen unbegreiflichen
Sinnlosigkeit. Ich sitze im hintersten Kämmerchen des Pfarrhauses, Tränen
laufen über mein Gesicht. Ich wollte den 46. Psalm noch einmal lesen,
der am 14. März dran war, aber ich schloß das Neue Testament wieder.
Wäre doch alles nur ein böser Traum!
Ich möchte aus ihm erwachen, zu Hause in Zweibrücken im Bett. Die
Turmuhr müßte sieben schlagen. Ich könnte aufstehen, zur Schule
gehen, Paul treffen. Doch es hilft alles nichts - es ist kein Traum.
Paul ist tot! Dieser fröhliche, lebenslustige Freund ist tot!
(...)
Schönbühl,
Landkreis Straubing-Bogen,
im Vorderen Bayrischen Wald
April/Mai 1945
Josef Fendl
Winnetous Enkel
… Ich
kam nach Straubing, wo ich in einem dreiwöchigen Lehrgang zum
Volkssturmmann ausgebildet wurde. Die "Uniform" der jüngsten
Vaterlandsverteidiger ließ sich als Gleichnis für die letzten Wochen
des Tausendjährigen Reiches ansehen: Die Sechzehnjährigen trugen
alle ihre gewöhnliche Werktagskleidung, ich zum Beispiel lange Strümpfe,
sogenannte Hochwasserhosen und eine geflickte Trachtenjoppe mit grünen
Eichenlaub-Applikationen. Dazu hatte man jedem aus den letzten, noch
verbliebenen NS-Beständen eine Armbinde des "Bundes Deutscher Mädel"
verpaßt!
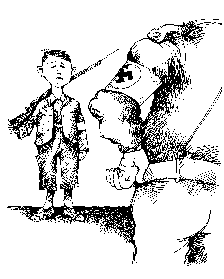
In
diesem Aufzug sollte ich mich mit meinen 16 Jahren als Volkssturmmann
den Feinden entgegenstellen.
Am Ostermontag, etwa drei Wochen vor dem Einmarsch der Amerikaner,
durfte ich mit meinen Volkssturmkameraden hinter der romanischen
Kirche St. Peter zum ersten und, Gott sei's gedankt, einzigen Mal in
meinem Leben scharf schießen. In den frischen Bombentrichtern an der
Alten Donau wurden wir in der Technik des Handgranatenwerfens
unterwiesen und mittels Papp-Plakaten wurde uns gelehrt, wie man -
fast - mühelos russische T34-Panzer knackte. Einer der beiden
Hauptleute, die dies mit emphatischen Worten zu demonstrieren
versuchten, mußte es wissen. Ihm hatte ein solches stählernes Ungetüm
ein Bein abgedrückt. Dem anderen hatte man an einer der zahlreichen
Fronten seinen rechten Arm zerschossen, damit das ewige Deutschland
leben konnte, wie es damals hieß.
Als ich nach dieser Nahkampfausbildung und mit dem moralischen
Imperativ nach Hause kam, im Falle einer notwendigen taktischen
Frontverkürzung aus jedem Kellerloch auf den entmenschten Feind zu
schießen, notfalls auch auf Verräter aus den eigenen Reihen, war
mein Vater gerade damit beschäftigt, den wenigen Hausrat im Garten zu
vergraben. Er fettete seine Pistole ein, die er aus dem Ersten
Weltkrieg mit heimgebracht und nie abgeliefert hatte, obwohl er
mehrfach dazu aufgerufen worden war, und wickelte ein paar alte Lumpen
darüber, bevor er sie zusammen mit Blechtassen und Bratpfannen der
stummen Mutter Erde anvertraute. Was nicht vergraben werden konnte,
wie das Fahrrad oder einige Möbelstücke, wurde im Keller
eingemauert.
Nach dem Verstauen des spärlichen Hausrats überlegten meine Eltern,
wie sie verhindern konnten, daß ich mit meinen 16 Jahren in den
letzten Kriegswochen noch zu den Waffen gerufen wurde. Favorit aller
in Betracht kommenden Möglichkeiten war das Versteck in der Scheune.
Mein Vater hatte es in tagelanger Arbeit und ganz im Geheimen
hergerichtet. Er hatte zunächst alles Stroh auf die Tenne gegabelt,
an die rückwärtige Scheunenwand aus Brettern und Balken einen
Unterstand gebaut, dann über dieser Bretterkammer und nach vorne zur
Tenne hin das ganze Stroh wieder aufgerichtet. Meterhoch und
zentnerschwer. Den Zu/Ausgang dieses Verstecks bildete eine "Tür",
die mein Vater sorgfältig aus der Scheunenwand herausgeschnitten
hatte. Eine dicke Schar dort aufgeschichteter Holzscheite ließ sie
wie hinter einer Tarnkappe verschwinden.

Mein
Elternhaus in Schönbühl im Vorderen Bayrischen Wald.
Zeichnungen: Josef Fendl
Ein großartiges Versteck für einen Jungen in einem Alter, in dem man
doch noch lieber von tapferen Rothäuten las als mit scharfen Panzerfäusten
zu hantieren. Leider wurde es nichts mit dem Bezug dieser genial
ausgedachten Wohnhöhle, deren Bewohnbarkeit ich nur allzu gern
getestet hätte. Meine Mutter hatte Angst, daß der Pueblo-Indianer
beziehungsweise Volkssturm-Deserteur in diesem selbstgewählten Gefängnis
ersticken könnte.
Möglichkeit Nummer zwei: eine Krankheit. Natürlich nicht so ein
ordinärer Schnupfen oder gewöhnliches Hals- oder Bauchweh, sondern
schon etwas Ordentliches, Vorzeigbares. Mein Vater wußte da einige
Hausmittel aus dem Krieg anno 1914/18. Wenn man sich diesen Roßkuren
unterzog, bekam man schlimmes Fieber oder andere eigenartige Zustände,
die es einem absolut unmöglich machten, stehenden Fußes dem größten
Feldherrn aller Zeiten zu folgen.
Aber auch diese Möglichkeit gefiel meiner Mutter nicht, weil man ja
nie wußte, welche Nachwirkungen man damit nolens volens in Kauf nahm.
Nach langem Hin und Her und manchem Für und Wider blieb die Variante
eines verbrannten Fußes übrig. Mit einem defekten Hals konnte man ja
immer noch marschieren und Handgranaten werfen. Also: Verbrühung, ein
Arbeitsunfall, wie er in der Landwirtschaft immer wieder mal passiert.
Mit Feigheit hatte das nichts zu tun. Im Ersten Weltkrieg sollte es
nach Vaters Erzählungen öfter vorgekommen sein, daß sich tapfere
Soldaten in den Fuß schossen. Ganz unabsichtlich, versteht sich.
Die Szenerie war bedrückend und beeindruckend zugleich. Auf dem Herd
brachte meine Mutter einen Topf heißen Wassers zum Kochen, während
sich mein Vater eine Arbeit im Stall suchte. Ich, der designierte Held
des Tages, stellte mich barfuß auf den Stubenboden und nahm selber
die Prozedur vor. Ich rückte den Topf von der Herdplatte und goß mir
mit dem Mut des römischen Helden Mucius Scaevola, der als Gefangener
der Etrusker seine rechte Hand im Herdfeuer verbrannte, um so seine
Furchtlosigkeit zu beweisen, die brodelnde Wassersäule auf den linken
Fuß. (...)
Brzeszcze,
nahe Auschwitz*), Oberschlesien;
30. Dezember 1944-Anfang Februar 1945
Günter
Aichele
Der rettende Engel
Unverkennbar
wurde die Lage mulmiger. Wir 16jährigen Schüler der
Dillmann-Oberschule in Stuttgart waren seit Juli 1944 als
Luftwaffenhelfer nahe Brzeszcze in Oberschlesien eingesetzt und
sollten hier die Industrieanlagen gegen Luftangriffe schützen. Am 30.
Dezember 1944 kam der Befehl, einige Geschütze für den Erdkampf,
also zur Panzerbekämpfung, vorzubereiten. Bei tiefgefrorenem Boden,
eisigem Wind und Schneefall waren Geschützwälle aufzuschaufeln. Die
Geschütze sollten auf Lafettenkreuze gestellt und mit einigen letzten
Stammsoldaten als mobile Flak-Kampftrupps an kritische Stellen der
Front geworfen werden.
Jetzt wurde es auch für uns Luftwaffenhelfer ernst. Am 12. Januar
1945 begann die sowjetische Großoffensive an der Weichselfront.
Hauptmann Ullmann, der den abwesenden Batteriechef Engel vertrat,
wurde am 15. Januar ebenfalls abkommandiert. Neuer Chef war nun
Leutnant Hansen, ein junger Kerl. Wir mußten annehmen, daß er
"Halsschmerzen" hatte und sich ein Ritterkreuz verdienen
wollte, denn er war fest entschlossen, die Stellung mit uns zu
verteidigen. Er ließ alle Vorbereitungen dazu treffen: Vorräte
hinter die Geschützwälle schaffen, das Eis in den Laufgräben
aufpickeln.

Auf
Transport. Im Juli 1944 waren wir Luftwaffenhelfer aus Stuttgart zum
Schutz der Industrieanlagen nach Oberschlesien, nach Brzeszcze bei
Auschwitz, verlegt worden.
Wir rüsteten
uns für einen Winterkrieg. Aus Leinentüchern wurden weiße Tarnumhänge
fabriziert, die Stahlhelme weiß angestrichen. Mein Schulkamerad
Hermann Burkhardt mußte eine Schablone anfertigen, mit der auf
Armbinden, die aus weißen Bettlaken geschnitten waren, in grüner
Farbe und mit einem Dienststempel versehen, die Aufschrift
"Deutsche Wehrmacht" aufgetragen wurde. Damit sollte den
Feinden kundgetan werden, daß sie es mit echten Kombattanten zu tun
hatten, denn nach der Haager Landkriegsordnung bestand zwischen
Kombattanten und waffentragenden Nichtkombattanten ein wesentlicher
Unterschied. Letztere brauchten nicht wie Kriegsgefangene behandelt zu
werden. Unsere HJ-Armbinden hatten wir schon verbrannt und uns dafür
den Luftwaffenadler auf die Uniform genäht. Die Armbinde (siehe Seite
120) besitze ich heute noch.
In unserer Stellung bei Brzeszcze herrschte Sorge und Angst. Wir
erfuhren, daß die Rote Armee im Norden schnell nach Westen vorstieß.
Russische "Hiwis" ("Hilfswillige") verschwanden,
nachdem sich einige bereits im Oktober davongemacht hatten. Durch das
Flak-Fernrohr konnten wir im Süden über den Beskiden die Angriffe
russischer Flugzeuge ausmachen. Es hatte sich ein Schlauch gebildet,
an dessen östlichem Ende wir saßen. Auschwitz war den Angreifern
offenbar nicht wichtig genug, um es in frontalem Angriff zu erobern.
Artilleriefeuer schien uns zu umkreisen. Russische Maschinen überflogen
jetzt häufig unsere Stellung. Hansen verbot deren Beschuß, weil er
die Munition für den kommenden Erdkampf sparen wollte. (Die 8,8
cm-Flak war wegen ihrer durchschlagenden Wirkung gegen Panzer gefürchtet.)
Wie die zu Festungen erklärten Orte sollten wir Hitlers
Wellenbrecher-Taktik in die Tat umsetzen. Wehe, wenn der Kommandant
eines solchen Wellenbrechers kapitulierte, weil weiterer Widerstand
sinnlos geworden war!
Uns erreichte die Meldung, daß die Untergruppe ihr Quartier geräumt
habe und daß dort einiges zu holen sei. Wie Hermann in sein Tagebuch
notierte, bestand das Ergebnis unseres Beutezuges in Fleischbüchsen,
Wein, Keksen kistenweise und Kunsthonig. Ich selbst kann mich nur an
weiße Skier entsinnen, von denen wir einige Paar in die Stellung
geschleppt hatten.
Von der Räumung des Konzentrationslagers Auschwitz erfuhren wir
offiziell nichts. Allerdings notierte Hermann in seinem Tagebuch,
Bremer Luftwaffenhelfer hätten ihm erzählt, daß sie sich aus den
Depots der SS reichlich bedient hätten: "Hunderte von Stiefeln,
Pelzmäntel, Pelzwesten, Wäsche, Füllfederhalter, Uhren, Gewehre mit
Munition, Pistolen, Konservenbüchsen, Wurst, Speck, Säue, alles, und
die Polen plündern. Brotlaibe zu Tausenden und wir hungern, weil
nichts mehr in die Stellung vorkommt."
Hermann hatte auch beobachtet, daß auf der Straße Auschwitz -
Brzeszcze Autos, Gespanne, Fuhrwerke, Krads, sogar ein Pferdepark mit
unzähligen Tieren zurückrollten. Am 20. Januar notierte er
Detonationen in sein Tagebuch, die von der Sprengung des Hydrierwerkes
herrühren sollten.
Mitten in diesem Irrsinn geschah ein Wunder: Am 24. Januar, zur
Mittagszeit, erschien wie aus einer anderen Welt in Gestalt von
Hauptmann Engel unser rettender Engel - zwei Tage, bevor es zu spät
gewesen wäre!
Er war gleich von Flakhelfern umringt. Wir trauten unseren Ohren kaum,
als er zu uns sagte: "Na, Kearls, jetzt vaschießn wa unsere
Munition und dann gehn wa stiftn."
Jetzt ging es "nur" noch darum, die Munition möglichst
militärisch sinnvoll zu "vaschießen", damit nicht gegen
den "Führerbefehl" gehandelt wurde. (Keine Stellung durfte
geräumt werden, solange noch Munition vorhanden war.) Die Lösung war
Sperrfeuer mit Hilfe eines auf dem ehemaligen Schießplatz Rajsko
stationierten vorgeschobenen Beobachters der Feldartillerie. Dieser
war mittels Feldtelefon mit der Batterieleitung verbunden. Wo genau
wir hinschossen, weiß ich nicht. Rajsko lag auf dem geraden Weg nach
Auschwitz, nicht ganz in der Mitte …
Gegen 19.30 Uhr kam der Abmarschbefehl für die Luftwaffenhelfer. Die
letzten Soldaten der Batterie und die Vorgesetzten blieben noch kurze
Zeit, um die Geschütze zu sprengen und die Baracken anzuzünden.
Einen schriftlichen Marschbefehl hatten wir nicht, die Batterie sollte
ja theoretisch beieinander bleiben. Wir hatten nur einen auf
Butterbrotpapier gezeichneten Wegeplan. (...)

Januar
1945 - Rückzug im Winter
Buchenwald
und Denstedt, bei Weimar - Hamburg
Anfang April-Ende Juni 1945
Günther
Jung
Das Dienstsiegel von Denstedt
Es war
Ende Juni 1945, ein heißer Sommer. Vom Dammtorbahnhof bis zur neuen
Wohnung meiner Eltern - das alte Haus in Brandsende war 1943
ausgebombt worden - mochten es noch 800 Meter sein. Was erwartete mich
daheim? Hinter mir lag eine Ewigkeit.
Anfang 1943 waren meine Klassenkameraden vom Jahrgang 1927 als
Luftwaffenhelfer eingezogen worden. Sie wurden auf der Elbinsel Hanöfersand
ausgebildet. Obwohl erst Anfang 1928 geboren, meldete ich mich
freiwillig zur Flak, um nicht ein Jahr später mit "Fremden"
dienen zu müssen. Luftwaffenhelfer zu sein empfanden wir als etwas
Besseres als den "Dienst" in der Hitler-Jugend, auch wenn
beim monatlichen Wochenendurlaub die HJ-Armbinde zur Uniform getragen
werden mußte. Doch die wurde meistens gleich nach Verlassen der
Flak-Stellung abgenommen.
Im Juli 1943 gab es die ersten großen Luftangriffe auf Hamburg.
Englische und amerikanische Bomber kamen zu Hunderten über die Elbe
geflogen. In sommerlich warmen Nächten schossen wir stundenlang - in
Badehose und mit Stahlhelm - auf zumeist unsichtbare Ziele am dunklen
Himmel. Die knappen Essensrationen wurden aufgegessen, sobald größere
Bomberverbände über Helgoland im Anflug nach Osten gemeldet waren.
Lieber am nächsten Tag hungern. Denn wir wußten nie, wie die Nacht
zu Ende gehen würde. "Pech gehabt" - ein häufig benutzter
Ausdruck jener Tage - war ein Teil des notwendigen Seelenpanzers. Nur
so ließen sich die furchtbaren Nachrichten von Tod und Elend
ertragen. Im ungeliebten militärischen Drill dieser Jahre haben sich
wohl zwei Fähigkeiten entwickelt, die im späteren Leben hilfreich
waren: das rechtzeitige Vorausahnen von Gefahren und eine manchmal
hilfreiche Portion Fatalismus.
Zusammen
mit drei meiner Hamburger Kameraden gehörte ich Anfang April 1945 zu
einer Flak-Erdkampftruppe, die zuletzt am Stadtrand von Weimar, in
bedrückender Nähe des Konzentrationslagers Buchenwald, eingesetzt
war. Nun als "richtige" Soldaten der Luftwaffe sollten wir
das immer kleiner werdende "Großdeutsche Reich"
verteidigen. Dabei hatten wir deutschen Städten längst russische
Namen wie Berlinograd oder Hamburgovskaja gegeben.

Das
Foto zeigt mich, vorn links, als Höhenricht-Kanonier an der 10,5
cm-Flak.
Überraschend war für uns, daß die Amerikaner offenbar feste
"Dienstzeiten" hatten, denn nachts konnten wir in unserer
Kaserne in Weimar noch ruhig schlafen. Nur morgens mußten wir
rechtzeitig in unseren Erdlöchern sein, wenn die ersten Jagdbomber
von Westen her anflogen. Es war für uns deprimierend, daß wir mit
unseren Karabinern allenfalls auf Tiefflieger schießen konnten. Wenn
die Amis ihre Bombenlast abgeworfen hatten, flogen gelegentlich
Zigarettenpackungen aus dem Cockpit hinterher. Darüber wunderten wir
uns schon.
Als der Geschützdonner bereits zu hören und zu spüren war, trieben
SS-Aufseher gequälte KZ-Insassen nachts in Richtung Osten. Man wollte
die "Volksfeinde" vor dem Anrücken der Amerikaner in andere
Lager verbringen. Die ausgehungerten Häftlinge konnten sich kaum auf
den Beinen halten. Viele hakten sich beim Nebenmann unter oder sie stützten
sich gegenseitig. Brach einer von ihnen vor Erschöpfung zusammen,
wurde er durch Genickschuß getötet. In unseren Erdlöchern hockend,
mußten wir verzweifelt mit anschauen, was hier vor sich ging. Gern hätten
wir irgend etwas für die armen Menschen getan. Aber was hätte es
geholfen, einen SS-Mann zu erschießen? Aus dem Lager wären andere
nachgerückt.
Mit den
ersten warmen Tagen im Jahr kamen sie dann: Am 12. April 1945 nahmen
die Amerikaner Weimar ein. Wir versteckten uns im nahen Wald bei einer
Fasanerie. Indessen konfrontierten die amerikanischen Truppen die Bevölkerung
mit den Realitäten des Konzentrationslagers Buchenwald. Mehrmals am
Tag wurden Einwohner Weimars in der Innenstadt auf Lastwagen verladen
und zum KZ gefahren. Blaß und schweigsam kamen sie zurück.
Am nächsten Tag liefen meine Hamburger Kameraden und ich einfach los,
heraus aus dem Wald, irgendwohin, wo nicht mehr geschossen wurde.
Erste Tauschgeschäfte mit ehemaligen polnischen Zwangsarbeitern
klappten ganz gut. Zigaretten gegen Kleidungsstücke, die keine
deutschen Uniformteile waren. Wir erreichten Denstedt, sieben
Kilometer nordöstlich von Weimar gelegen. Ein Rittergut wie aus dem
Bilderbuch mit einem Wehrturm und Scharten um die Gebäude.
Amerikanische und deutsche Soldaten hatten sich hier in der Nacht
zuvor aus ihren Panzern heraus beschossen. Der Pferdestall war total
ausgebrannt. Wir vier Jungen waren auf dem Hof willkommen und durften
bleiben. Es mußte vieles aufgeräumt werden.

Meine
Hamburger Klassenkameraden vom Jahrgang 1927 und ich waren 1943/44 als
Luftwaffenhelfer eingesetzt. Ich stehe vorn rechts.
Wir sollten uns um die Kühe und Kälber im Stall kümmern, denn die
polnischen und russischen Zwangsarbeiter, die hier gearbeitet hatten,
waren inzwischen auf und davon. Um 4 Uhr morgens weckte uns der
Schweizer mit energischem Klopfen an unser Zimmerfenster. Anfangs
hatten wir große Abneigung, wenn nicht gar Ekel vor dem Stalldreck.
Das Ausmisten der 84 Stallplätze, Füttern und Tränken der Tiere,
das alles sollte bis zum Frühstück erledigt sein. Wir bräuchten
viel zu lange, machte uns der Schweizer täglich in breitem thüringischem
Dialekt klar. Die schwere Arbeit ging uns Stadtjungen eben nicht so
leicht von der Hand.
Das Dorf hatte nur gut 100 Einwohner. Die kleinen Häuser lagen, am
Gutshof beginnend, beiderseits der engen Straße. Wie überall zu
dieser Zeit waren fast nur Frauen, Kinder und Alte im Dorf. Die
Amerikaner fuhren ständig Patrouille, so daß wir selbst abends den
durch Mauern gut geschützten Hof nicht verlassen konnten. Es war
besser, die ungeliebte Arbeit im Kuhstall zu verrichten denn als
Kriegsgefangener in einem der riesigen Lager mit unbestimmter Zukunft
zu landen. So beschränkten wir unsere Spaziergänge auf den kurzen
Weg um einen hinter dem Gut gelegenen kleinen Teich, der von der Straße
her nicht einsehbar war.
Ein weiteres Problem war die Melker-Chefin. Sie hatte drei Töchter,
die sie wohl gern mit uns verkuppelt hätte. Wir könnten doch zu
Pfingsten mit ihnen wandern gehen, sie wolle auch einen Kuchen backen.
Die Mädchen fürchteten wir zwar nicht, aber die amerikanischen
Patrouillen um so mehr. Als die Chefin begriffen hatte, daß wir
partout nicht mit ihren Töchtern ausgehen wollten, tröstete sie sich
mit der frappierend einfachen Feststellung: "Ist ja klar, die
Jungen kommen aus Hamburg, sicher besitzen ihre Väter große Schiffe,
da wollen sie eben nicht mit unseren Töchtern gehen."
Nach und nach ging uns die Arbeit im Stall schneller von der Hand. Es
war ziemlich heiß. Hatten wir anfangs noch unsere Knobelbecher
getragen, liefen wir jetzt längst barfuß, so blieb uns wenigstens
das lästige Stiefelputzen erspart. Den Stallgeruch trugen wir ohnehin
mit uns herum.
Es muß Anfang Juni 1945 gewesen sein, wir saßen gerade zwischen
unseren doppelstöckigen Betten am Mittagstisch, als plötzlich vom
Hof her unverständliche Laute zu uns hereindrangen. Kurzes Poltern an
der Tür, dann standen sie auch schon im Zimmer: Männer in
Lederjacken, Russen oder Polen. Eine junge Südländerin übersetzte:
"Ihr SS - raus!"
Ehemalige Buchenwald-Häftlinge waren auf Jagd nach ihren Peinigern.
Auf dem Hof mußten wir uns alle mit erhobenen Armen und dem Gesicht
zur Wand stellen. Zuerst wurden wir nach Waffen durchsucht. Zum Glück
war die Pistole, die ich mir in den letzten Kriegstagen organisiert
hatte, längst in dem nahen Teich versenkt worden. Dann mußten wir
unsere Ärmel aufkrempeln, weil man sehen wollte, ob wir die
Blutgruppentätowierung der Waffen-SS tragen. Jetzt wäre unsere
Luftwaffen-Uniform möglicherweise eine gute Legitimation gewesen.
Plötzlich hieß es, wir sollten mitkommen. Im nächsten Moment jedoch
tauchte der deutsche Leutnant auf, der, von den Amerikanern offiziell
aus dem Kriegslazarett in Weimar beurlaubt, mit seiner Frau ebenfalls
auf dem Gutshof wohnte. Er trug noch seine Wehrmachtsuniform. Der
Offizier war nun wichtiger, sein selbstbewußtes Auftreten hatte die
Aufmerksamkeit der Besucher auf sich gelenkt. Sie führten ihn schließlich
ab, während wir anderen zurückbleiben durften. Von nun an war uns
klar: Wir hatten nicht nur die amerikanische Gefangenschaft zu befürchten,
sondern auch die Verwechslung mit SS-Schergen. Daher beschlossen wir,
schon sehr bald in Richtung Norden aufzubrechen. Von der Gutsherrin,
einer sympathischen alten Dame, wurden wir enttäuscht, sie gab uns
nur ein paar Scheiben Brot mit auf den Weg. Vielleicht hatten auch wir
sie enttäuscht. Wer konnte von heute auf morgen unsere Arbeit im
Stall übernehmen?
Wir brauchten unbedingt Papiere, denn unsere verräterischen Soldbücher
waren längst im Backofen der Gutsküche verbrannt worden. Der alte
Dorfschmied fungierte jetzt als Bürgermeister, jedenfalls verfügte
er über einen Gemeindestempel. Er unterschrieb uns ein Dokument
"To whom it may concern", das uns als landwirtschaftliche
Lehrlinge auswies, die zurück in ihre Heimatstadt Hamburg wollten. Ob
unser Schulenglisch zusammen mit dem Gemeindesiegel vor den Militärkontrollen
der Amerikaner bestehen würde?
Unser Heimweg - zu Fuß von Thüringen bis in die Rothenbaumchaussee
von Hamburg - war lang und beschwerlich. Dreimal hatte uns die
Gefangennahme durch Amerikaner und im Norden durch Engländer gedroht,
wäre da nicht das kleine, amtliche Papier mit dem Dienstsiegel des
Dorfschmieds von Denstedt gewesen. Zuletzt brachte uns ein Lastwagen
der Hamburger Polizei, beladen mit Kartoffeln aus der Lüneburger
Heide, über die Elbe. Nichts ging unkontrolliert von britischem Militär
durch dieses Nadelöhr. Unser "Ausweis" half sogar noch drei
jungen Mädchen, die sich mit uns auf den Kartoffelsäcken über die
Elbe schmuggeln ließen. Die englische Patrouille verglich mehrmals
die verzeichneten Namen mit der Anzahl der Personen. Unsere doppelten
Vornamen auf dem Papier verwirrten den Tommy derart, daß er das Zählen
- one, two, three - bald aufgab.
Wir vier Kameraden trennten uns am Deichtormarkt. Das letzte Stück
des Weges ging nun jeder allein. Allein mit seinen Gedanken, seinen Ängsten.
Ob das Haus noch stand? Ob die Eltern und die Geschwister noch lebten?
Vor dem Curio-Haus sah ich plötzlich Militärpolizei und Soldaten in
Jeeps. Sollte ich so kurz vor dem Ziel umkehren? Bestimmt würden sie
an meinen Knobelbechern und der Uniformhose mit Koppel erkennen, woher
ich kam. Oben trug ich allerdings eine zerschlissene Baumwolljacke und
über der Schulter hing eine recht zivile Tragetasche. Der geschnitzte
Wanderstock konnte sie vielleicht vom Koppelschloß ablenken. Nur
gelassen bleiben und unauffällig vorbeigehen.
Ich hatte Glück, es gab keine Kontrollen. Wie ich bald erfuhr, wurden
hier von der britischen Besatzungsmacht die ersten
Kriegsverbrecherprozesse durchgeführt. Die Absperrung hatte dem
ungehinderten Zugang der Militärrichter und Angeklagten ins Gericht
gegolten. Während des Krieges hatten in dem Gebäude
Gesellschaftsabende und Parteiveranstaltungen der NSDAP stattgefunden.
Schon von weitem sah ich, daß das Haus, in dem meine Eltern wohnten,
noch stand. Auch das Dach war heil. Also mußten sie noch am Leben
sein. Angespannt betrat ich das unversehrte Treppenhaus. Selbst der
Lift war intakt. An der Wohnungstür hing noch das Schild mit unserem
Namen. Auf mein Klingeln öffnete mein Bruder Walter. Mit ihm hatte
ich am allerwenigsten gerechnet. Vierzehn Jahre älter als ich, war er
viel länger Soldat gewesen und nun schon vor mir zu Hause. Unsere
Mutter kam in die Diele geeilt und fiel weinend in Ohnmacht. Neun
lange Monate hatten meine Eltern nicht gewußt, ob ihr jüngster Sohn
noch lebte.
Inhalt
Orte
8
Chronologie 1944/45 10
Vorbemerkungen 16
Paul
Misch
Im Niemandsland 19
Wolfgang Diebold
Im Strudel der Ereignisse 28
Elisabeth Dörffel
Zwölf Tage bis Berlin 41
Benno Götzke
Zweimal Prisoner of War 53
Gerda Keller-Freitag
Und ich lebte weiter 67
Carl Raddatz
Endzeit 77
Renate Rochner
Könnte ich doch in die Zukunft sehen! 95
Klaus Lazarek
Der Zug – unser Zuhause 101
Günter Aichele
Der rettende Engel 114
Günter Paff
„Geh doch hin, wo du hergekommen bist!“ 125
Siegfried Allzeit
Letzte Tage in Königsberg 130
Marlis Föhr
Die Brücke – unser Schicksal 147
Kurt Klose
Geheime Kommandosache 152
Rudi Brill
Fronthelfer der Hitler-Jugend 159
Dorothea Helbig
Dienst in der Festung 180
Harry Banaszak
Meldegänger 187
Margit Heidecker
Im Kunstbunker 192
Josef Fendl
Winnetous Enkel 207
Klaus Richter
Nun erst recht! 214
Helmut Schinzel
Mit 17 fängt das Leben an 228
Günther Jung
Das Dienstsiegel von Denstedt 243
Charlotte Schyma
Kriegsdienst auf Rügen 251
Joachim Meyer-Quade
Brückenwache 262
Änne Behrends
Der Weg ins Ungewisse 277
Karl-Heinz Götzl
Brennesseln – das kleinere Übel 282
Wolfgang Herchner
„Und grüß mir Hamburg!“ 285
Rolf Zabel
Gershwin 292
Dietwart Nehring
Besiegte und Sieger 299
Irmgard Notz
Die Schreckenstage 308
Siegfried Dostal
Die Letzten der Oderfront 315
Ingeborg Hoffmann-Sagebiel
In uns ist Hoffnung 327
|